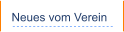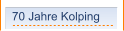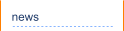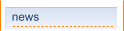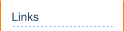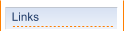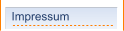Geschichte
1846 bis 1865: Gründung und Ausbau
Das Werk von Kolping Adolph Kolping prägte die erste Phase des Kolpingwerkes: die Zeit von der
Gründung des ersten Gesellenvereins in Elberfeld 1846 bis zu seinem Tode am 4. Dezember 1865.
In diesen wenigen Jahren entstanden mehr als 400 Gesellenvereine sowohl in Deutschland als
auch in zahlreichen europäischen Ländern und in Nordamerika. Die rasche Ausbreitung des
Katholischen Gesellenvereins zeigt, dass Kolpings Idee auf fruchtbaren Boden fiel. Denn er traf die
spezifischen Bedürfnisse der jungen Gesellen nach allgemei fachlicher und religiöser Bildung.
Überdies boten die Gesellenheime vielen jungen wandernden Handwerkern eine familiäre
Gemeinschaft und Heimstätte. So konnte Kolping in Zeiten bitterer Not das Elend der Gesellen
lindern und ihre Chancen auf eine bessere Zukunft erhöhen. Mehr als hunderttausend junge
Menschen hatten dann auch
schon zu Lebzeiten Kolpings die "Schule" des Gesellenvereins durchlaufen und erfuhren
wichtige Impulse für ihre Lebensgestaltung als tüchtige Christen.
Organisation Adolph Kolping selbst war mit seinen zahlreichen Reisen, Reden und publizistischen
Tätig-keiten der treibende Motor für die Ausbreitung seines Werkes. Die Gesellen taten das ihre
dazu. Auf ihrer Wanderschaft trugen sie die Idee Kolpings in die Welt hinaus und gründeten
vielerorts neue Vereine. Damit die Ausbreitung in geregelten Bahnen verlief schuf Kolping
verbindliche Grundlagen für das Werk.
So schlossen sich auf seine Anregung hin bereits 1850 die ersten Vereine – Elberfeld, Köln und
Düsseldorf – zum „Rheinischen Gesellenbund“, dem späteren „Katholischen Gesellenverein“
zusammen. Eine Satzung, die sog. Generalstatuten sollten verbindlich die Vereinsarbeit regeln.
Diese wurden auf den Generalversammlungen des Verbandes von Zeit zu Zeit zur Diskussion
gestellt undden jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Kolping selbst sprach sich immer wieder
aus für eine moderate Anpassung des Vereins an veränderte Umstände und
Entwicklungen. Die Generalversammlungen der Jahre 1858 und 1864 waren von besonderer
Bedeutung. Hier wurden grundlegende Strukturen geschaffen, die im Kern bis heute bestehen. Seit
dieser Zeit sind die lokalen Vereine, die so genannten Kolpingsfamilien, innerhalb eines
Bistums in einem Diözesanverband zusammengeschlossen. Die Kolpingsfamilien bzw.
Diözesanverbände innerhalb eines politisch selbständigen Landes bzw. Staates bilden
einen Landesverband. Die Zentralverbände bilden zusammen das Internationale Kolping-werk mit
dem Generalpräses an der Spitze. Mit dieser Organisationsstruktur ist sowohl die enge Anbindung
an die Kirche vorgezeichnet als auch die Berücksichtigung der
politischen Verhältnisse. Die örtlichen Angelegenheiten der lokalen Gesellenvereine
wurden in Ortsstatuten geregelt. Diese mussten konform zu den allgemeinen Bestimmungen des
Generalstatuts sein.
Kolpingwerk Deutschland
Das Kolpingwerk Deutschland ist ein katholischer Sozialverband mit bundesweit 240.884
Mitgliedern in 2.512 Kolpingsfamilien, davon 41.914 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene im Bereich der Kolpingjugend (Zahlen Stand: 31.12.2015). Es ist Teil des
Internationalen Kolpingwerkes und des Kolpingwerkes Europa.
Im Sinne Adolph Kolpings will der Verband Bewusstsein für verantwortliches Leben und
solidarisches Handeln fördern. Dabei versteht sich das Kolpingwerk als Weg-, Glaubens-,
Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Schwerpunkte des Handelns sind die Arbeit mit und für
junge Menschen, unser Engagement in der Arbeitswelt, das Zusammenwirken mit und der
Einsatz für Familien und für die Eine Welt.
Adolph Kolping
Vom Schuhmacher zum Sozialreformer
Adolph Kolping (1813-1865) - Wegbereiter für die katholische Sozialbewegung und Vorbild für
uns heute.
Adolph Kolping - Tabellarischer Lebenslauf.
8.12.1813 Adolph Kolping wird in Kerpen bei Köln geboren
1820 - 1826 Besuch der Volksschule
1826 - 1837 Lehre und Gesellenzeit als Schuhmacher
1837 - 1841 Schüler des Marzellengymnasiums in Köln
1841 - 1842 Studium an der Universität München
1842 - 1844 Studium an der Universität Bonn
1844 - 1845 Priesterseminar in Köln
13.4.1845 Priesterweihe in der Minoritenkirche
1845 - 1849 Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld
7.1847 Präses des Elberfelder Gesellenvereins
1.4.1849 Domvikar in Köln
6.5.1849 Gründung des Kölner Gesellenvereins
1.1.1862 Rektor der Minoritenkirche
22.4.1862 Päpstlicher Geheimkämmerer
4.12.1865 Todestag
30.4.1866 Überführung der Gebeine Kolpings in die Minoritenkirche
27.10.1991 Seligsprechung in Rom